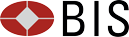Agustín Carstens speaks about the return of central bankers to Basel and the challenge of inflation
Interview (only available in German) with Mr Agustín Carstens, General Manager of the BIS, in Bilanz, conducted by Mr Dirk Schütz and published on 29 July 2022.
Alle zwei Monate treffen sich die Chefs der grössten Notenbanken hier bei Ihnen in Basel zu einem dreitägigen Austausch - die Zusammenkunft gilt als mächtigster Wirtschaftsclub der Welt. Findet das "Global Economy Meeting" wieder physisch statt?
Wir hatten im Mai wieder unser erstes grosses physisches Treffen nach der Pandemie. Unsere Mitglieder waren sehr froh, sich endlich wieder persönlich zu treffen. Fast alle sind gekommen.
Wo liegt der Unterschied zu den endlosen Videokonferenzen?
Als ich Gouverneur der mexikanischen Notenbank war, kam ich 48 Mal hierher, da hatte sich eine gewisse Routine eingestellt. Aber wenn man für zwei Jahre gar nicht gekommen ist, merkt man erst bei der Rückkehr, wie speziell diese Treffen und diese Organisation sind. Auf Regierungsebene gibt es so häufige und regelmässige Treffen nirgends. Ich war auch Finanzminister, da gab es Treffen auf regionaler Ebene und die Tagungen des Internationalen Währungsfonds. Aber was wir hier geschaffen haben, ist einmalig. Manche sagten nach der Rückkehr: "Mir war gar nicht klar, wie schön Basel ist."
Ein sehr enger und vertrauter Kreis.
Die Fluktuation ist niedrig. Es gibt einen Sinn für Kameradschaft, manche kommen seit mehr als zehn Jahren, alle sind per Du. Und keiner schickt seinen Stellvertreter. Notenbankchefs haben in ihren Heimatländern niemand auf Augenhöhe. Da schätzen sie den Austausch hier ungemein. Bei Technologiefragen etwa ist der Abgleich sehr hilfreich, 80 bis 90 Prozent der finanztechnologischen Entwicklungen können geteilt werden. Oder das Thema Klimawandel: Wie weit ist es unsere Aufgabe, uns zu engagieren? Das können wir hier besprechen, oft auch informell. Das ist eine sehr grosse Hilfe.
Am Schluss des letzten Sitzungstages steht immer ein sagenumwobenes Dinner, bei dem angeblich erlesenste Weine serviert werden.
Wir bieten anständige Weine, aber keine extrem teuren Flaschen. Es gibt hier auch keinen Weinkeller.
Angesichts der aktuellen Lage ist man versucht zu sagen: Da braucht es guten Wein, um sie zu ertragen. Ihr ökonomischer Jahresbericht findet stets grosse Beachtung, in diesem Jahr aber besonders: "Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg ist die globale Wirtschaft von Inflation bedroht, vor dem Hintergrund erhöhter finanzieller Anfälligkeit", schreiben Sie. Wie dramatisch ist die Lage?
Es ist eine Situation, welche die totale Aufmerksamkeit der Zentralbanken erfordert. Sie wurden gegründet, um staatliches Geld bereitzustellen und den Austausch von Geld zu ermöglichen. Und das bedeutet implizit, dass sie dafür verantwortlich sind, dass Geld seinen Wert behält.
Warum ist die aktuelle Lage für die Zentralbanken die grösste Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg?
Was die Lage so speziell macht: Erstmals seit 80 Jahren ist die Inflation ein globales Phänomen. Die Anzahl der betroffenen Länder ist sehr gross: Etwa drei Viertel der Staaten auf der Welt haben derzeit eine Inflationsrate von mehr als fünf Prozent. Ich komme aus einem Schwellenland, da habe ich mehrere derartige Episoden erlebt, zehn Prozent Inflation in Mexiko gab es häufiger. Aber dieses Mal sind viel mehr Länder betroffen und vor allem auch die grossen Volkswirtschaften der Industriestaaten. Und das ist umso gravierender, weil es nach einer langen Phase passiert, in der nicht die Inflation, sondern das Fehlen von Inflation das Problem war.
Inflation wurde ruckartig vom Freund zum Feind.
Die Zentralbanken hatten die Inflation sehr lange unter Kontrolle. Die letzte Inflationsphase gab es in den siebziger Jahren. Damals war unser Verständnis von Inflation noch nicht sehr gross. Jetzt haben wir mehr Erfahrung und deutlich bessere Instrumente. Aber hinter uns liegen drei schwierige Jahre, die aus Sicht der Geldpolitik sehr komplex waren.
Die Notenbanken müssten "schnell und entschieden handeln", fordern Sie in dem Bericht ungewohnt drastisch. Tun sie das?
Ja, ich finde schon. Gewiss, im Nachhinein hätte man sagen können, dass sie schneller hätten reagieren müssen. Aber man hat eben nie einen vollständigen Informationsstand. Was die Situation so komplex macht: Als Covid begann, redeten wir über Deflation, Massenarbeitslosigkeit und ein weltweites Firmensterben. Die Finanzminister und Notenbankchefs haben schnell und aggressiv geantwortet. Dann kam die frohe Nachricht der Impfstoffe, und die Wirtschaft kam sehr schnell zurück. Die Geschwindigkeit der Erholung war rasant.
Die Börsen und viele andere Vermögensklassen überschossen.
Ja, es war ein Überschiessen. Was wir aber nicht mit voller Klarheit gesehen haben: die Disruption, welche die Corona-Politik für die Wirtschaft mit sich brachte. Die Lockdowns bedeuteten: Man stellt den Motor der Wirtschaft ab. Und wir dachten: Wenn wir ihn wieder anstellen, läuft alles wieder normal. Doch wenn viele Security-Mitarbeiter entlassen wurden und Personen nicht mehr in Bereichen arbeiten wollen, in denen sie dem Virus ausgesetzt sind: Dann kann es eben nicht die gleiche Zahl an Flügen in Heathrow oder Amsterdam geben. Diese Probleme existieren in vielen Bereichen, dazu kommen die gerissenen Lieferketten. Durch das "Internet of Things" ist etwa die Abhängigkeit von Computerchips viel grösser geworden, ein Auto hat heute mehr Chips als ein Computer. Wenn die Lieferung stockt, verlangsamt sich die Herstellung, und die Preise gehen durch die Decke. Das ist ein vollkommen neues Umfeld, und wir haben nicht gesehen, wie stark diese Einflüsse sein werden und wie langsam sie sich lösen lassen.
Wäre es Aufgabe der Notenbanken gewesen, diese Probleme zu lösen?
Nein. Normalerweise bekämpft man derartige Schocks nicht mit Geldpolitik. Man lässt den Problemen Zeit, damit sie sich im freien Markt selbst lösen. Aber wenn diese Probleme nicht verschwinden, können sie die wirtschaftlichen Erwartungen beeinflussen. Und das hat dann Einfluss auf die Inflationsdynamik.
Welche Rolle spielt der Zeitfaktor?
Eine grosse. Der Turnaround kam im letzten Jahr extrem schnell, aber die Fiskalund Geldpolitik lässt sich nicht so schnell anpassen - ein Tanker lässt sich eben nicht schnell drehen. Das hat die Inflation verstärkt. Und dann kam ein unerwartetes und desaströses Ereignis dazu: der russische Angriff auf die Ukraine. Die Preisanstiege bei den Rohstoffen sind enorm, und sie kamen sehr schnell.
Sie sagen, die Notenbanken täten genug. Aber die Inflation liegt in den USA bei über neun Prozent, in Europa bei fast acht Prozent. Die Leitzinsen sind aber immer noch deutlich tiefer - sie liegen selbst in den USA bei nicht einmal zwei Prozent. Sind die Notenbanken nicht noch immer viel zu zaghaft?
Wir müssen uns über die Komponenten der Inflation im Klaren sein, das ist ein zentraler Bestandteil unserer Forschung. Wenn ein grosser Teil aus Disruptionen und externen Schocks stammt, ist vieles noch non-monetär. Wir messen das über die sogenannte Kern-Inflation. Sie liegt noch immer deutlich unter den ausgewiesenen Inflationsraten.
Die grosse Geldschwemme seit der Finanzkrise wirkt bislang also nicht inflationär?
Nach unseren Berechnungen spielt sie für die aktuelle Inflationsentwicklung keine bedeutende Rolle. Wenn dagegen der Ölpreis stark sänke, käme der Rückgang der Inflation sehr schnell. Die Zentral-banken müssen das Signal senden, dass sie die Inflation bekämpfen. Aber sie dürfen auch die Wirtschaft nicht abwürgen. Ein Overkill könnte einen Abschwung bewirken, der grösser ist als nötig. Das ist ein schwieriger Prozess. Wir Ökonomen und Zentralbanken haben viele Modelle und verstehen die Dynamik von Inflation recht gut. Aber es ist eben bei den Wendepunkten dieser Entwicklungen sehr schwierig. Das ist dann eine Kunst, keine Wissenschaft. Der Plan ist, dass wir die Geldpolitik stark genug straffen, um die Inflationserwartungen zu senken, aber gleichzeitig die Wirtschaftskorrektur nicht zu stark ausfallen lassen.
Das berühmte Soft Landing. Wann erreicht denn die Inflation gemäss Ihren Prognosen ihren Höhepunkt?
Wir gehen heute davon aus, dass viele dieser externen Schocks sich bald korrigieren werden.
Was heisst bald?
In den nächsten 18 Monaten oder so. Die Covid- und Zulieferprobleme dürften sich schneller lösen. Aber China bleibt ein Fragezeichen, auch für die Lieferketten. Die Entwicklung im Ukraine-Krieg ist schwer vorhersehbar, wobei die Erfahrung zeigt, dass die Akteure mit der Zeit meistens einen Weg finden, Verknappungen zu lösen. Wenn nicht neue grosse Schocks kommen, sollten wir in den USA bereits in der zweiten Jahreshälfte eine Verbesserung sehen.
Dennoch warnen Sie eindringlich vor einem Hoch-Inflations-Umfeld, angetrieben durch eine Lohn-Preis-Spirale. Wie gross ist diese Gefahr?
Das Risiko ist hoch. Es ist deshalb zentral, dass die Notenbanken entschieden handeln. Wenn die Bürger sehen würden, dass die Institution, welche die Inflation bekämpfen soll, nichts tut, würden sie sich zu Recht Sorgen machen. Entscheidend ist, dass die Erwartungen nicht ausser Kontrolle geraten. Wenn das passiert, kommen wir von einem Niedrig-Inflations-Umfeld zu einem Hoch-Inflations-Umfeld. Dann wird die Situation instabil.
Aber eben: Die Zinserhöhungen sind noch immer mild.
Ich bin für schrittweise Anpassungen, um das Risiko zu reduzieren, dass man zu stark strafft. Man muss auch beachten, dass die Finanzierungskonditionen bereits deutlich straffer geworden sind. Die Hypozinsen etwa sind stärker gestiegen als die Leitzinsen, genauso wie die Zinsen für Unternehmensanleihen. Sie nehmen die Aktionen der Zentralbanken vorweg.
Die Zentralbanken haben in den letzten Jahren für die Inflation ein Zwei-Prozent-Ziel verfolgt. Wäre es sinnvoll, dieses Ziel jetzt auf vier Prozent anzuheben?
Das denke ich nicht. Auch das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Besonders in einer Phase hoher Inflation sollten die Notenbanken nicht zu diesem Schritt greifen. Vor zwei Jahren machten wir uns noch Sorgen, dass das Zwei-Prozent-Ziel zu hoch lag.
Wie sehen Sie die drei grossen Wirtschaftsblöcke USA, Europa, Asien?
In den USA ist der Arbeitsmarkt viel angespannter, die Arbeitslosenquote befindet sich auf Tiefstand. Das ist in Europa nicht der Fall, zudem ist hier das Rohstoffproblem viel grösser, besonders beim Gas. Asien hält sich relativ gut. China und Japan sind die beiden grossen Volkswirtschaften, in denen es kein Inflationsproblem gibt.
Ist eine Währungsunion in dieser schwierigen Zeit ein Nachteil? Die italienischen Anleihen schiessen in die Höhe, die Angst vor einer neuen Eurokrise geht um.
Es gibt keinen Grund, darin einen Nachteil zu sehen. Natürlich soll die Geldpolitik für jedes einzelne Land optimal sein. Aber die EZB kümmert sich darum, und ich denke, sie hat die notwendigen Instrumente, um die Inflation zu bekämpfen und gleichzeitig eine Fragmentierung im Euroraum zu vermeiden.
Und die Schweiz? Die Zinserhöhung der SNB war überraschend - vor allem, weil sie vor der EZB kam.
Die Schweiz hat das bisher sehr gut gemanagt.
Noch ist die Inflation tief.
Aber man spürt sie. Ich spüre sie, wenn ich in den Supermarkt gehe. Und die Bürger sehen, dass die verantwortliche Institution ihren Job macht.
Erhalten Sie Ihren Lohn in Franken?
Ja - mit Inflationsanpassung (lacht).
Die Krise hat die Börsen einbrechen lassen, besonders dramatisch ist der Absturz der Kryptowährungen. Ihnen obliegt über den Basler Ausschuss auch die globale Bankenaufsicht. Wie gehen die Zentralbanken damit um?
Wir müssen das sehr genau anschauen. Die Risiken für die Finanzstabilität sind momentan zum Glück relativ tief. Die Banken sind genügend kapitalisiert. Aber die Kryptoszene ist ein Gebiet, das uns Sorgen macht. Wir haben schon länger vor Governance-Problemen gewarnt. Dieser Krypto-Meltdown ist für uns deshalb keine Überraschung.
Wie gefährlich ist er für die Stabilität?
Er ist keine systemische Gefahr. Wir haben die Beziehungen im Kryptobereich zu den grossen Finanzinstituten analysiert und dort auch Regulierungsvorschläge gemacht - sie müssten alle Positionen mit Kapital hinterlegen.
Die Kryptoszene wirft den Zentralbanken vor, dass sie deswegen so kritisch sind, weil sie die neuen digitalen Währungen nicht kontrollieren.
Wir haben als öffentliche Institution die Verpflichtung, den Bürger aufzuklären, was passiert. Kryptowährungen bringen grosse Risiken mit sich.
Welche?
Es besteht die Gefahr der kriminellen Nutzung, es droht Hacking, und auch der Konsumentenschutz ist nicht gesichert. Wir als Notenbanken können diese Szene nicht vollständig regulieren.
Tun die Regierungen genug bei der Regulierung der Kryptobranche?
Sie liegen ein paar Schritte zurück. Es ist Zeit, dass die Regeln verschärft werden.
Wie steht es mit dem Digitalgeld der Notenbanken?
Wir nennen das CBDC: Central Bank Digital Currency. Dafür überführen wir Geld in eine neue technologische Anwendung. Die Gesellschaft will eine andere Darstellung von Zentralbankgeld. Alle haben Smartphones. Es ist deshalb unsere Pflicht, diese neue Form zu bieten.
Wann wird das marktreif sein?
Das hängt von den einzelnen Ländern ab. Mehr als die Hälfte der Zentralbanken arbeitet aktiv daran, die anderen begleiten es. Das digitale Geld wird in naher Zukunft kommen. Aber wir können uns hier keine Pannen leisten: In Zentralbanken muss das System perfekt funktionieren.
Wie wichtig ist Basel für die BIZ - und die BIZ für Basel?
Es ist eine extrem produktive und glückliche Beziehung. Basel war immer ein sehr guter Gastgeber für uns. Aber die BIZ bringt auch Basel viel. Wenn man nach Basel in englischsprachigen Nachrichten sucht, wird unser Basler Ausschuss für Bankenaufsicht als Erstes genannt. Es folgen die Art Basel, Roche, Novartis und dann die BIZ selbst - sogar vor dem FC Basel und Roger Federer.