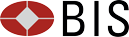Agustín Carstens speaks on central bank policy, debt and digital currencies
Interview (only available in German) with Mr Agustín Carstens, General Manager of the BIS, in Neue Zürcher Zeitung, conducted by Mr Thomas Fuster and Mr Christoph Eisenring and published on 10 October 2020.
Wegen der Corona-Krise liegen die Leitzinsen vielerorts bei null oder gar im negativen Bereich. Haben die Notenbanken damit ihre Munition verschossen?
Von den Zinsen her könnte man das meinen, aber gibt es noch genügend Spielraum. Die Notenbanken können ihre Bilanzen kreativ einsetzen. In Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie haben sie etwa Firmenanleihen gekauft und die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen direkt unterstützt. Darüber hinaus können sie mit ihrer Kommunikation die Erwartungen über den zukünftigen Pfad des Zinsniveaus beeinflussen.
Wenn aber eine Notenbank einzelne Firmen direkt unterstützt, verbessert sie gezielt deren Finanzierungsbedingungen. Sollten Notenbanken da nicht neutral sein?
Der Einsatz unkonventioneller Instrumente geht mit zunehmenden Bedenken einher. Die Notenbanken würden es vorziehen, nicht auf dieses Terrain vorstossen zu müssen. Aber wir sind da, weil die Umstände so schwierig sind. Gewiss, was früher für die Geldpolitik «rote Linien» waren, wurde überschritten. Aber man tat das in vollem Bewusstsein der Risiken getan.
Von welchen roten Linien sprechen Sie?
Denken Sie an negative Leitzinsen. In meiner Studienzeit wäre jemand, der das vorausgesagt hätte, für verrückt gehalten worden. Das ist aus intellektueller Warte eine «rote Linie». Ein anderes Beispiel ist der direkte Kauf von Staatsanleihen durch die Notenbank.
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat aufgrund ihrer Devisenkäufe mittlerweile eine Bilanzsumme, die 130% der Wirtschaftsleistung beträgt. Gibt es für die Grösse von Notenbankbilanzen irgendeine kritische Grenze?
Nichts kann für immer wachsen. Solange es aber eine grosse Nachfrage für Franken gibt, ist es nachvollziehbar, dass die SNB diese bedient. Käme sie dieser Nachfrage nicht nach, würde der Franken stark aufwerten. Das würde der Schweizer Wirtschaft enorm schaden.
Wenn die Notenbank ihr Geld direkt an Haushalte oder Firmen verteilen würde - wäre mit solchem «Helikoptergeld» für Sie eine rote Linie überschritten?
Wir sollten das nicht grundsätzlich ausschliessen. Ich hoffe aber, dass wir nie an einen Punkt gelangen, an dem dies nötig sein wird. Wenn aber Deflation droht, könnte Nichtstun gefährlicher sein.
Sind wir schon dort?
Nein, das sind wir nicht.
Die SNB interveniert seit Jahren massiv am Devisenmarkt. Ist die Schweiz deshalb ein «Währungsmanipulator»?
Das sehe ich nicht so. Die SNB verfolgt kein Wechselkursziel. Die Nachfrage nach Schweizer Franken ist ein Nebeneffekt der weltweit sehr lockeren Geldpolitik. Die Schweizer Wirtschaft hat aber nicht die Kapazität, alle diese Zuflüsse zu absorbieren. Also stemmt sich die SNB dagegen. Bei den Devisenkäufen handelt es sich um eine defensive Massnahme.
Als Grundproblem erscheint uns, dass die Geldpolitik in der Vergangenheit sehr asymmetrisch war. Bei Turbulenzen lockerte man rasch, bei Erholungen zog man die Zügel aber nicht wieder an.
Immerhin haben die Notenbanken über die ganze Zeit für eine niedrige und stabile Teuerung gesorgt. Von daher kann man nicht behaupten, die Notenbanken hätten die Normalisierung der Geldpolitik verschlafen. Gleichzeitig sollten sie aber Gelegenheiten nutzen, um die Zügel zu straffen. Möglichkeiten dazu gab es aber nicht viele.
Das Fed hat seine Strategie angepasst; die Europäische Zentralbank (EZB) steht kurz davor. Beide wollen vorübergehend auch Inflationsraten über 2% tolerieren. Was halten Sie davon?
Es geht um Feinabstimmungen. Niemand will, dass die Inflation auf 5% steigt. Derzeit liegt das Ziel bei 2%. Es ist aber schwierig, ein Ziel punktgenau zu treffen. Deshalb will das Fed künftig nur noch im Durchschnitt 2% anstreben. Für die Schweiz kann man sagen, dass sie mit der Vorgabe einer Bandbreite von 0 bis 2% gut gefahren ist.
Wären das Fed und die EZB gut beraten, statt eines Punktziels ebenfalls eine Bandbreite zu definieren?
Eine Bandbreite ist vernünftig. Allerdings kann man argumentieren, dass es dann schwieriger würde, die Inflationserwartungen zu verankern. Als ich Gouverneur der Zentralbank von Mexiko war, lautete die Vorgabe 3% plus/minus ein Prozentpunkt. Damit kam ich gut zurecht. Entscheidend ist immer, dass eine Notenbank ihr Ziel einer niedrigen Teuerung durch eine Strategieänderung nicht verwässert.
Seit einigen Monaten beobachten wir eine Abschwächung des Dollars. Ist dies der Anfang vom Ende des Dollars als globaler Leitwährung?
Nein, davon sind wir weit entfernt. Er bleibt die dominante Währung. Finanzierungen in Dollar sind sehr wichtig für die Weltwirtschaft. Zur Stabilisierung des globalen Finanzsystems musste das Fed jüngst viel Dollar-Liquidität bereitstellen. Die Geldpolitik des Fed zielt nicht auf den Wechselkurs, da die USA eine relativ geschlossene Volkswirtschaft sind. Die geldpolitischen Lockerungsmassnahmen in den USA führten allerdings zu einer Schwächung des Dollars. Das hat aber nichts zu tun mit einer geringeren Nachfrage nach Dollar oder der Erwartung, der Dollar werde künftig eine geringere Rolle spielen.
Dennoch, Amerikas rasch wachsende Staatsschulden des Bundes werden 2021 erstmals grösser sein als die nationale Wirtschaftskraft. Untergräbt das nicht die Dominanz des Dollars?
Nein. Der Appetit auf Dollar-Anlagen ist gross. Man muss die Verschuldung der USA immer in Relation zur Schuldenkapazität sehen. Und in Amerika ist die Steuerlast noch relativ gering. Braucht das Land zusätzliche Mittel, gibt es noch Ressourcen.
Die Staatsschulden steigen nicht nur in den USA, sondern weltweit. Das macht es für Notenbanken immer schwieriger, die Zinsen zu erhöhen. Denn bei höheren Zinsen könnten einige Länder unter ihrer Schuldenlast kollabieren. Sind wir mittlerweile so weit, dass die Geldpolitik primär darauf abzielt, das finanzielle Überleben der Staaten sicherzustellen?
Sie sprechen das Problem der «fiskalischen Dominanz» an. Kommt es dazu, erhalten fiskalische Überlegungen bei der Festlegung der Geldpolitik plötzlich mehr Gewicht als geldpolitische. Von einer solchen Situation sind wir jedoch weit entfernt. Gewiss, in einigen Ländern haben Notenbanken staatliche Schuldpapiere gekauft. Das ist aber ein vorübergehendes Phänomen, um Staaten in schwieriger Lage zu helfen. Denn was zu Beginn dieses Jahres geschah, ähnelte einem Krieg.
Inwiefern?
In einem Krieg muss ein Staat sehr schnell seine Ausgaben erhöhen. Und der Markt kann die zusätzlichen Schulden nicht so rasch absorbieren. In einer solchen Situation können Notenbanken in die Bresche springen, um eine Destabilisierung des Finanzsystems zu verhindern.
Wenn Notenbanken aber immer mehr Schuldpapiere des Staates aufkaufen, führt dies schleichend zu einer Staatsfinanzierung über die Notenpresse - das endete in der Geschichte nie gut.
Zentral sind die institutionellen Regeln. Diese müssen sicherstellen, dass die Zentralbank jederzeit sagen kann: «So, jetzt ist es genug». Die Notenbanken müssen daher stets erklären, was sie warum tun und wo die Grenzen ihres Tuns liegen. Schauen Sie auf die Bank of England. Als diese der Regierung im April direkt Finanzmittel zur Verfügung stellte, machte sie klar, weshalb sie sich für diese aussergewöhnliche Massnahme entschieden hatte.
Die Bank of England sagte, es handle sich nur um eine «temporäre Massnahme». Doch Politiker werden sagen: Wenn ihr es einmal getan habt, könnt ihr es auch ein zweites Mal tun.
Dann muss eine Zentralbank eben Stärke zeigen und klar machen, dass es kein zweites Mal gibt.
Die Krise führt dazu, dass sich die meisten Staaten massiv verschulden. Wie lange kann das so weitergehen, ehe es zu einer ernsthaften Destabilisierung des globalen Finanzsystems kommt?
Zweifellos sind die Risiken für das globale Finanzsystem grösser geworden. Das ist offenkundig. Wir wissen aus der Vergangenheit: Mit steigender Verschuldung steigt die Wahrscheinlichkeit von Finanzkrisen. Deshalb schenken die Notenbanken der Finanzstabilität wachsende Aufmerksamkeit. Um die Risiken besser kontrollieren zu können, wären zusätzliche Massnahmen erforderlich.
Was für Massnahmen?
Es gibt beispielsweise Finanzvehikel im Nichtbankensektor, sogenannte Geldmarktfonds, die sich im Markt in hohem Mass mit Schuldpapieren eindecken. Diese Fonds tragen Zinsrisken, sind aber kaum reguliert. Bei Zinsschwankungen können Verluste entstehen, was wiederum einen Run auf diese Fonds auslösen kann. Entsprechend wichtig wäre es, bei solchen Vehikeln die Anforderungen bezüglich Liquidität zu verschärfen.
Rund um den Globus gewinnen digitale Währungen an Bedeutung. Für Schlagzeilen sorgt etwa die von Facebook propagierte Libra-Währung. Was halten Sie von Libra?
Libra ist ein wichtiges Ereignis in der Geschichte des Finanzwesens. Erstmals mobilisiert eine private Initiative zahlreiche Reaktionen.
Das ist angesichts des heftigen Widerstands aus der Politik sehr milde ausgedrückt.
Libra ist zusammen mit Bitcoin und anderen Finanzinnovationen ein Weckruf für die Notenbanken, sich mehr Gedanken zu machen über moderne Zahlungssysteme. Libra ist mit Blick auf die Funktionen von Geld als Wertaufbewahrungsmittel, Tauschmittel und Recheneinheit aber suboptimal. Nationale Währungen erfüllen diese Funktionen besser und haben eine Zentralbank im Rücken. Rund um Libra als Stablecoin gibt es viele ungelöste Fragen. Daher kommt Libra auch kaum vorwärts.
Fragen wir grundsätzlicher: Ist der Markt für Geld ein normaler Markt? Oder ist Geld ein öffentliches Gut, das nur vom Staat angeboten werden soll?
Meines Erachtens ist Geld ein öffentliches Gut. Nur staatliches Geld mit vertrauensvollen Institutionen kann die erforderliche Liquidität und den nötigen Schutz liefern, damit eine Währung dauerhaft wertstabil ist. Allein die Tatsache, dass der Wert von Libra durch etablierte nationale Währungen unterlegt werden muss, spricht Bände.
Befürworter privater Währungen sagen, mehr Wettbewerb führe zu besseren Währungen, wie in jedem anderen Markt.
In der Weltwirtschaft schneidet die grosse Mehrheit der nationalen Währungen sehr gut ab. Oder haben Sie irgendwelche Probleme mit dem Franken?
Wohl kaum. Wettbewerb ist zweifellos wichtig, jedoch vor allem bei der Verwendung von Geld, mit dem Ziel, Transaktionen im In- und Ausland zu vereinfachen. Hier sollte der Wettbewerb ansetzen. Und hier können Projekte wie Libra viel bewirken. Ich sehe das Projekt daher als eine öffentlich-private Partnerschaft.
An Zentralbanken werden immer mehr Anforderungen gestellt. Es reicht längst nicht mehr, dass sie sich nur um Preisstabilität kümmern. Verlangt wird auch, dass sie das Finanzsystem stabilisieren, für Vollbeschäftigung sorgen, den Klimawandel bekämpfen, soziale Verteilungsprobleme anpacken und vieles mehr. Das tönt nach einer massiven Überforderung der Geldpolitik.
Ja, es gibt viele Erwartungen. Einige könnten die Zentralbanken erfüllen, aber sicher nicht alle. In manchen Gebieten fehlen den Währungsbehörden schlicht die Instrumente. Das sollte man ehrlicherweise auch sagen.