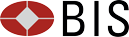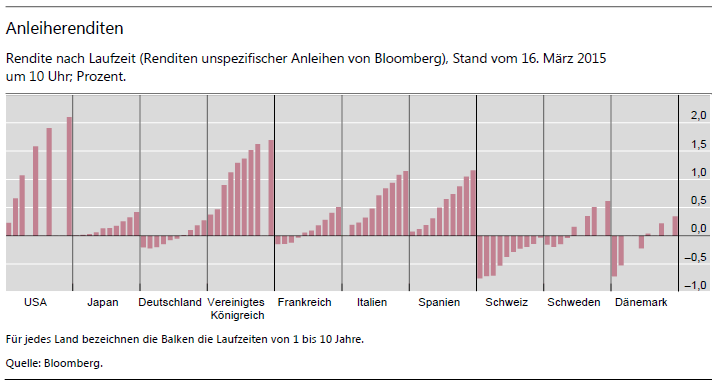BIZ-Quartalsbericht März 2015 - Medienorientierung
Die Features geben die Meinung der Autoren wieder, die sich nicht unbedingt mit dem Standpunkt der BIZ deckt. Wenn Sie in Ihrem Artikel über die Features schreiben, beziehen Sie sich bitte auf die Autoren und nicht auf die BIZ.
On-the-Record-Kommentare von Claudio Borio, Leiter der Währungs- und Wirtschaftsabteilung, und Hyun Shin, Volkswirtschaftlicher Berater & Leiter Wirtschaftsforschung, 16. März 2015.
Claudio Borio
Die Grenzen des Undenkbaren sind derzeit aussergewöhnlich dehnbar - dies demonstrieren uns die Anleihemärkte jeden Tag aufs Neue. Ende Februar wiesen langfristige Staatsschuldtitel im Wert von rund $ 2,4 Billionen weltweit negative Renditen auf. Davon waren über $ 1,9 Billionen allein von Ländern des Euro-Raums aufgelegt worden. Und seither hält der Abwärtstrend der Renditen an. Die neuesten Zahlen zeigen negative Renditen für französische, deutsche und Schweizer Staatsanleihen bis zu 4, 6 bzw. 10 Jahren.
In den Abenteuern des Tom Sawyer von Mark Twain besteht das Geheimnis guten Taktierens darin, dass Toms Freunde den Zaun anstreichen und ihn für dieses Privileg noch bezahlen. So betrachtet haben es einige Länder in Toms Taktik zu neuer Meisterschaft gebracht.
Die unmittelbare Erklärung für diese beispiellose Situation liegt auf der Hand. Schon länger haben die Zentralbanken die Geldpolitik energisch gelockert, um ihr Mandat - nicht zuletzt in Bezug auf die Inflation - erfüllen zu können. In jüngster Zeit war es die EZB, die die drastischsten Massnahmen ergriff und die Märkte mit dem Umfang und der unbefristeten Dauer ihres grossvolumigen Programms zum Ankauf von Vermögenswerten überraschte. Seit Anfang Dezember haben allerdings mehr als 20 Zentralbanken die Geldpolitik gelockert, und auch hier war dieser Schritt von den Marktteilnehmern häufig nicht erwartet worden. Einige Zentralbanken - beispielsweise die People's Bank of China oder die Reserve Bank of India - reagierten in erster Linie auf binnenwirtschaftliche Faktoren; andere - wie die Schweizerische Nationalbank oder die Danmarks Nationalbank - taten dies mit Blick auf äussere Faktoren, nachdem ihre Wechselkurse unter enormen Druck geraten waren bzw. zu geraten drohten. Ganz allgemein gesehen, können an stark integrierten Finanzmärkten sogar flexible Wechselkurse keine wirkliche Abgrenzung garantieren. Denken wir daran, dass das Sonderziehungsrecht - ein Korb der wichtigsten Reservewährungen - derzeit eine 3-Monats-Rendite von weniger als 5 Basispunkten aufweist. In einem solchen Umfeld erzeugt eine Lockerung die nächste.
Mit ihren Massnahmen haben die Zentralbanken deutlich gemacht, dass die sog. Nullzinsgrenze doch recht porös ist. Negative Leitzinsen am kurzen Ende, teilweise verbunden mit grossvolumigen Ankäufen von Vermögenswerten am längeren Ende, haben sowohl die Laufzeitprämien als auch die nominalen Renditen unverkennbar noch stärker in den negativen Bereich gedrückt. Hält diese beispiellose Entwicklung weiter an, dürften die technischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und sogar politischen Grenzen wohl ausgetestet werden. Die Konsequenz dieser Entwicklung sollte genau beobachtet werden, da die Auswirkungen auf das Finanzsystem und darüber hinaus zweifellos bedeutsam sein werden.
Die Kombination negativer Zinssätze und grossvolumiger Ankäufe von Vermögenswerten im Euro-Raum ist teilweise der Grund für eine weitere aussergewöhnliche Entwicklung: In den letzten Monaten scheinen die Renditen von Euro-Raum-Anleihen die Renditen von US-Anleihen massgeblich beeinflusst zu haben. Nach der Ankündigung der EZB fielen die Renditen 10-jähriger deutscher Bundesanleihen um 13 Basispunkte, und die Renditen entsprechender US-Schatztitel um nicht weniger als 9 Basispunkte.
Derart niedrige Sätze sind gleichzeitig Folge und Katalysator der beiden anderen wesentlichen Faktoren, die das gegenwärtige Finanzumfeld prägen. Sie sind teilweise Ausdruck des drastischen Einbruchs der Ölpreise, der, zusammen mit geringeren Preisrückgängen anderer Rohstoffe, die kurzfristigen disinflationären Tendenzen verstärkte. Und sie haben für eine noch deutlichere Aufwertung des US-Dollars gesorgt, im Einklang mit den divergierenden - gegenwärtigen und künftigen - geldpolitischen Rahmenbedingungen und Wirtschaftsaussichten. Der handelsgewichtete Wechselkurs des US-Dollars ist seit Mitte 2014 um nicht weniger als etwa 20% gestiegen - eine der grössten je über einen ähnlichen Zeitraum verzeichneten Aufwertungen. Derweil hat der Euro gegenüber dem Dollar noch rascher abgewertet, und eine Parität der beiden Währungen scheint mittlerweile in Reichweite.
Was bedeutet all dies für die gegenwärtigen internationalen Finanzierungsbedingungen - also für die globale Liquidität? Können der Euro und der Yen den US-Dollar als wichtigsten Bestimmungsfaktor für die Liquidität ablösen? Vielleicht, aber wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen Grad. Der US-Dollar bleibt die wichtigste Währung im Welthandel, und dies führt zu einer strukturellen Nachfrage nach Dollarmitteln. Und unabhängig von neuen Mittelströmen spielt der ausstehende Bestand eine wichtige Rolle für die Finanzierungsbedingungen, da die bestehende Schuldenlast durch Schwankungen der Wechselkurse und Zinssätze verändert wird. An diesem ausstehenden Bestand hat der US-Dollar den mit Abstand grössten Anteil: Kredite an Nichtbanken ausserhalb der USA in Höhe von mehr als $ 9 Billionen lauten auf diese Währung. Der Euro liegt mit deutlichem Abstand an zweiter Stelle: In dieser Währung wurden $ 2,3 Billionen - zumeist an Schuldner in Nachbarländern des Euro-Raums - vergeben. Da dem so ist, wird eine weitere Aufwertung des US-Dollars per saldo tendenziell zu schwierigeren internationalen Finanzierungsbedingungen führen, vor allem wenn zu der Aufwertung noch eine Straffung der US-Geldpolitik hinzukommt.
Unterdessen sind die Schwachstellen langsam grösser geworden, und zwar als Folge des kräftigen Kreditwachstums in mehreren Ländern, die von der Krise weniger stark betroffen waren. Im aktuellen BIZ-Quartalsbericht werden verschiedene Indikatoren für die globale Liquidität vorgestellt und in einen grösseren Zusammenhang gebracht: Sie werden in Beziehung zu den inländischen finanziellen Entwicklungen ganz allgemein gesetzt, etwas, was wir künftig in regelmässigen Abständen tun werden.1 Aus den entsprechenden Statistiken wird eine Reihe von Entwicklungen deutlich: Nach dem Kreditboom vor Ausbruch der Krise kam es nach der Krise insgesamt zu einem Rückgang der internationalen Bankkreditvergabe, hauptsächlich weil die Kreditströme innerhalb der fortgeschrittenen Volkswirtschaften zurückgingen. Gleichzeitig hielt die kräftige Kreditexpansion in vielen aufstrebenden Volkswirtschaften an und übertraf teilweise das inländische Kreditwachstum. In diesen Ländern kam es auch zu einem sprunghaften Anstieg der US-Dollar-Kredite. Ausserdem verlagerte sich die Mittelaufnahme von Bankkrediten zur Kapitalmarktfinanzierung. Schliesslich gab es - wenn auch ausnahmslos vage - Anzeichen für einen Aufbau finanzieller Ungleichgewichte im Inland.
Unter dem Strich haben die globalen Liquiditätsbedingungen die entsprechenden inländischen Bedingungen verstärkt. Bemerkenswerterweise deuten die jüngsten Zahlen darauf hin, dass die Finanzbooms in einigen aufstrebenden Volkswirtschaften ins Stocken geraten sind. Nicht zuletzt hat sich das Wachstum der Forderungen der BIZ-Berichtsbanken gegenüber China deutlich verlangsamt. Es betrug über das Quartal gesehen im dritten Quartal 2014 nur noch 3%. Die Interbankforderungen gingen sogar zurück. Die mögliche Wende inländischer Finanzzyklen angesichts der Tatsache, dass US-Dollar-Finanzierungen knapper werden, muss genau beobachtet werden.
Unterdessen hat sich das Renditestreben fortgesetzt, und auch die Märkte sind nach wie vor abhängig von geldpolitischen Lockerungsmassnahmen. Dies belegen die jüngsten Marktturbulenzen nach der Veröffentlichung positiver Beschäftigungszahlen in den USA, die vermuten lassen, dass es eher früher als später zu einer Leitzinsanhebung kommen wird. Die Volatilität ist wieder auf historische Durchschnittswerte gestiegen, was auf ein weniger aggressives Eingehen von Risiken hindeutet. Märkte können jedoch nicht liquide bleiben, wenn der Weg für einen geldpolitischen Kurswechsel über derart lange Zeit schmaler geworden ist. Darüber soll man sich keine Illusionen machen.
Ich werden nun an meinen Kollegen Hyun Shin übergeben, der sich ebenfalls zu einigen dieser Punkte äussern wird.
Hyun Shin
Kommen wir nun zu den Features in dieser Ausgabe des BIZ-Quartalsberichts.
Wie immer haben wir versucht, eine Reihe von Artikeln zu aktuellen Themen zusammenzustellen.
Dieses Mal befassen wir uns mit den wirtschaftlichen Kosten einer Deflation, der Entwicklung der Investitionen nach der Finanzkrise, der Rolle der Verschuldung im jüngsten Ölpreisverfall, den Auswirkungen von finanzieller Inklusion auf die Zentralbankpolitik sowie der Marktliquidität.
Aus Zeitgründen möchte ich vor allem drei Artikel kommentieren.
Der erste behandelt die wirtschaftlichen Kosten einer Deflation; Verfasser sind Claudio Borio, Magdalena Erdem, Andrew Filardo und Boris Hofmann. Der Artikel untersucht historische Daten zum Zusammenhang zwischen Deflation und Wirtschaftswachstum.
Der jüngste Preisverfall beim Öl und bei anderen Rohstoffen hat weltweit die Inflationsraten nach unten gedrückt, teilweise sogar in den negativen Bereich. Im Januar war die Jahresteuerungsrate in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften gerade noch positiv, und in den aufstrebenden Volkswirtschaften lag sie unter 3%.
Die in dem Feature aufgezeigte Faktenlage sollte uns zu denken geben.
Erstens waren Deflationen - einfach definiert als sinkende Preise von Gütern und Dienstleistungen - im Zeitraum ab 1870 recht häufig. In den 38 untersuchten Volkswirtschaften herrschte während rund 18% der Zeit eine Deflation. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Deflationen allerdings weit weniger häufig und von kürzerer Dauer.
Zweitens beschwört in öffentlichen Debatten der Begriff „Deflation" Bilder der Weltwirtschaftskrise herauf, mit drastischen Produktionseinbussen und Massenarbeitslosigkeit. Doch die historischen Daten deuten darauf hin, dass die Weltwirtschaftskrise die Ausnahme und nicht die Regel war. Gewiss ist das durchschnittliche Wachstum höher, wenn die Preise steigen, als wenn sie fallen, aber dieser Zusammenhang ist praktisch ausschliesslich den Verhältnissen rund um die Weltwirtschaftskrise zuzuschreiben.
Drittens stellen die Autoren bei vertiefter Prüfung der Daten fest, dass es insbesondere in Phasen sinkender Immobilienpreise zu viel stärkeren Einbrüchen der Wirtschaftsleistung kam als bei Güterpreisdeflationen.
Viertens schliesslich gibt es bisher kaum Hinweise darauf, dass Deflationen mit Schuldendeflationsspiralen - sinkende Preise erhöhen die Schuldenlast, was wiederum die Wirtschaftstätigkeit bremst - verbunden gewesen wären.
Wechseln wir nun das Thema und kommen wir zum Feature über Marktliquidität und Marktmachertätigkeit an den Festzinsmärkten.
Meine Kollegen Ingo Fender und Ulf Lewrick werteten einen kürzlich zu diesem Thema erschienenen Bericht eines Zentralbankausschusses aus und dokumentieren, wie sich die Marktliquidität nach der weltweiten Finanzkrise verändert hat.
Während an den Staatsanleihemärkten wieder ähnliche Liquiditätsbedingungen herrschen wie vor der Krise, ist dies in anderen Segmenten des Festzinsmarktes nicht der Fall. Beispielsweise sind die Märkte für Unternehmensanleihen offenbar weniger liquide als früher. Zwar liegen die Geld-Brief-Spannen wieder nahe am Vorkrisenniveau, aber es bleibt eine gewisse Skepsis, wie gut der Markt grosse Transaktionen verkraften würde, insbesondere wenn viele Händler gleichzeitig risikobehaftete Bestände abstossen wollten.
Wir haben Beispiele für grosse Preisveränderungen an Märkten erlebt, die normalerweise sehr tief und liquide sind: der US-Schatztitelmarkt im vergangenen Oktober oder - zuletzt - die heftigen Preisausschläge am Schweizer-Franken-Markt im Januar. Glücklicherweise hatte keines dieser beiden Ereignisse dauerhafte Folgen für die Finanzstabilität, aber was an Finanzmärkten geschieht, bleibt nicht immer auf diese begrenzt. Wir tun daher gut daran, genau auf mögliche Auswirkungen von Finanzmarktturbulenzen auf die Realwirtschaft zu achten.
Das Feature über Öl und Verschuldung veranschaulicht einige ähnliche Lehren. Zusammen mit Dietrich Domanski, Jonathan Kearns und Marco Lombardi bin ich Autor dieses Artikels. Wir zeigen auf, dass die Verschuldung des Ölsektors weltweit zweieinhalbmal so hoch ist wie 2006 und Ende 2014 $ 2,5 Billionen betrug.
Aus dem Beispiel des Wohnimmobilienmarktes in der Finanzkrise haben wir gelernt: Wenn ein Wirtschaftssektor stark verschuldet ist, kann ein sinkender Wert der zugrundeliegenden Aktiva zu kurzfristigen Störungen führen, die einen etwaigen Anfangseffekt noch verstärken.
Die anhaltend hohen Förderquoten und der rasante Aufbau von Öllagerbeständen dürften zum Teil auf den Barmittelbedarf der Produzenten für die Bedienung ihrer Schulden zurückzuführen sein.
Insbesondere zeigen wir, dass aus Absicherungsgeschäften von Ölproduzenten eine vielsagende, nach unten weisende Reaktion auf der Angebotsseite hervorgeht, bei der sinkende Preise mit erhöhten Ölverkäufen am Futures-Markt verbunden sind.
In welchem Masse Verkäufe an einem einbrechenden Markt eine sich verstärkende Preisreaktion auslösen, hängt von der Marktliquidität und der Fähigkeit der Händler ab, die Verkäufe zu absorbieren.
Der kürzlich eingetretene rapide Ölpreisverfall könnte teilweise darauf zurückzuführen sein, dass die Swaphändler die Verkäufe nicht mehr so gut absorbieren können. Mit dieser Bemerkung schliesst sich der Kreis zum zuvor erwähnten Feature über Marktliquidität.