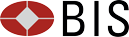76. Jahresbericht 2005/06
BIS Annual Economic Report
|
26. Juni 2006
Der Bericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich über das 76. Geschäftsjahr (1. April 2005 - 31. März 2006) wurde der ordentlichen Generalversammlung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich am 26. Juni 2006 in Basel vorgelegt.